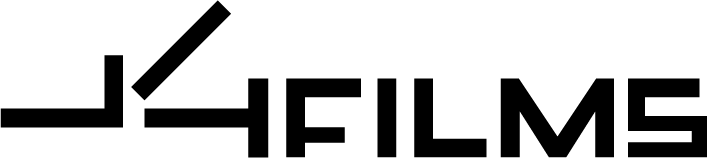● 21.9.2022, 20:00 Uhr
→ Schloßtheater
Ein Film von Xavier Giannoli nach dem Roman von Honoré de Balzac
Illusions perdues – Frankreich 2021 – Regie: Xavier Giannoli – Drehbuch: Jacques Fieschi, Xavier Giannoli – Kamera: Christoph Beaucarne – Mit Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar, André Marcon u.a. – OmU – 149 min
Frankreich im 19. Jahrhundert: Der junge und hoffnungsvolle Lucien (Benjamin Voisin) widmet seine ganze Leidenschaft der Dichtkunst. Doch in der heimatlichen Provinz ist sein Talent nutzlos. Die Chance der ländlichen Enge zu entkommen, bietet sich, als seine heimliche Geliebte Louise (Cécile de France) nach Paris geht. Er verlässt Hals über Kopf die familiäre Druckerei und versucht fortan an der Seite seiner Geliebten in der märchenumwobenen Stadt Paris Fuß zu fassen und in der Gesellschaft aufzusteigen.
In den Intellektuellenkreisen von Paris fällt sein Talent auf fruchtbaren Boden. Der windige Chefredakteur einer auflagenstarken Zeitung, Étienne Lousteau (Vincent Lacoste), bringt ihn in die richtigen Kreise. Schnell avanciert Lucien zur „Edelfeder“ des Blattes, seine Theaterrezensionen sind gefürchtet. Sogar der wichtigste Verleger der Stadt, Dauriat (Gérard Depardieu), umgarnt den Schriftsteller, um sein erstes Buch herauszubringen.
Als sich Lucien in die bildschöne Schauspielerin Coralie (Salomé Dewaels) verliebt, wendet sich das Blatt: ein Rückschlag folgt dem anderen und hinter den Kulissen offenbaren sich ihm die wahren Mechanismen der gesellschaftlichen Macht: Profit, Schein und Fake News. Die anfängliche Naivität ist bald verflogen und Lucien lernt schnell, dass das Leben in Paris einer menschlichen Komödie gleicht, in der einfach alles und jeder käuflich ist. Lucien durchläuft eine bittere Schule des Lebens und muss sich entscheiden, welchen Weg er gehen will.
Xavier Giannolis Verlorene Illusionen basiert auf dem Roman Illusions perdues von Honoré de Balzac und feierte seine Weltpremiere im Wettbewerb der 78. Internationalen Filmfestspiele von Venedig.
Mit insgesamt sieben Awards ist Verlorene Illusionen von Xavier Giannoli der große Gewinner der diesjährigen Césars: Bester Film; Bester Nebendarsteller (Vincent Lacoste); Bester Nachwuchsdarsteller (Benjamin Voisin); Bestes adaptiertes Drehbuch; Bestes Szenenbild; Beste Kostüme und Beste Kamera.