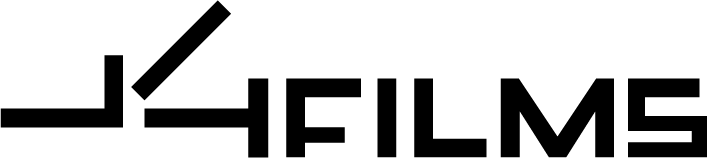● 11.9.2022, 20:00 Uhr
→ Schloßtheater
Ein Film von Erik Poppe nach dem Roman von Vilhelm Moberg
UTVANDRARNA – Schweden 2021 – Regie: Erik Poppe – Drehbuch: Siv Rajendram Eliassen & Anna Bache-Wiig – Kamera: John Christian Rosenlund – Musik: Johan Söderqvist – Mit Lisa Carlehed, Gustaf Skarsgård, Tove Lo, Kerstin Linden, Sofia Helin, Lena Strömdahl u.a. – OmeU – 146 min
Fünfzig Jahre nachdem Regisseur Jan Troell für seine Adaption Emigranten Max von Sydow und Liv Ullmann in die neue Welt auswandern ließ, adaptiert Erik Poppe (Utøya 22. Juli) die klassische Auswanderer-Geschichte von Vilhelm Moberg in berückend schönen Bildern und aus konsequent weiblicher Perspektive.
The Emigrants erzählt die Geschichte von Kristina Nilsson, einer Mutter, die in den 1850er Jahren mit ihrer Familie das verarmte Schweden verlässt und sich auf eine lange, gefährliche Reise begibt, in der Hoffnung, in Amerika ein besseres Leben für sich und ihre Kinder zu finden.
Das epische Drama The Emigrants stammt vom international gefeierten Regisseur Erik Poppe. Der Film ist mit Lisa Carlehed (The Tunnel) und Gustav Skarsgård (Vikings) in den Hauptrollen besetzt. Weitere Darsteller sind der internationale Popstar Tove Lo und Sofia Helin (Die Brücke). Der Film basiert auf Vilhelm Mobergs beliebter Romanreihe, die ab 1949 erschien und 1971 von Jan Troell erstmals als Film adaptiert wurde, der für fünf Oscars nominiert war und zwei Golden Globes gewann.