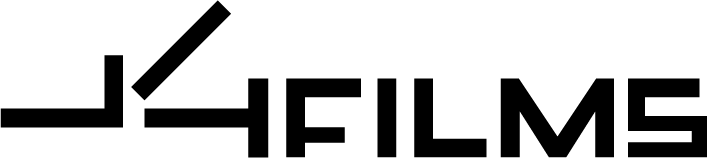Filmkritik: Falcon Lake
Von Julius Kuebart
(K)eine Schwester? – Charlotte Le Bons Falcon Lake überzeugt als filmische Graphic Novel mit düsterem Anschlag.

Nur die ersten Töne, die ersten gebrochenen Akkorde des Stückes werden angespielt. Aber das genügt, um die vertrauten Klänge der wahrscheinlich bekanntesten Sonate Beethovens zu erkennen – die Mondscheinsonate, quasi una fantasia. Nur eine kurze, schnell verklungene Szene. Aber düster nachhallend. Sie vereint als klangliches Sinnbild ideal die zwei zentralen Themen des Films: eine jugendliche Liebesschwärmerei, über der von Beginn an eine Schwere, Bedrohlichkeit, ein dunkler Schatten schwebt. Und gleichsam einer Fantasie treibt angeblich sogar ein Geist sein Unwesen im nahen See – ein fantastisches Ende ist da vorprogrammiert. Das mag wie eine hoffnungslos überstrapazierte Ausgangssituation klingen und auf den ersten Blick auch tatsächlich so wirken – dann packt der Film einen doch.
Aber von vorne. Durchaus virtuos führt uns die kanadische Regisseurin Charlotte Le Bon in die Handlung und Umgebung ihres Spielfilmdebüts ein. Ausführlich wird die kanadische Natur vorgestellt und man merkt schnell, dass die Regisseurin sich hier auf einem vertrauten Terrain befindet, aus ihrer Kindheit wie sie in einem Interview angibt. Die Schauplätze, der trübe See „mit seinem dunklen, bedrohlichen Wasser“ und selbst die einzelnen Bäume wirken mit Bedacht ausgewählt. Ausbleibende Musik verstärkt diesen Eindruck, wirft mit lauter Stille aber erste Schatten auf die Atmosphäre. Schnelle Schnittfolgen kontrastieren starre Szenen und es entsteht mit unspektakulären, fast minimalistischen Mitteln eine wirkungsvolle Bildästhetik – keinesfalls zufällig, denn subtil wird so die literarische Vorlage des Films samt Genre visuell aufgegriffen: die Graphic Novel Une Soeur (dt.: Eine Schwester) von Bastien Vivès.
Ebenso portraithaft werden wir den Protagonisten vorgestellt: der 13-jährige Bastien, der mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder Titi den Sommerurlaub am titelgebenden Falcon Lake verbringt. Es könnte also ein ruhiger Familienurlaub werden – bis Bastien des Nachts bei Blitz und Donner und – natürlich – bei Mondschein einen Blick auf seine drei Jahre ältere Zimmernachbarin erhascht. Die Familie ist zu Gast bei einer Freundin der Eltern und deren Tochter, der sechzehnjährigen Chloé. Lässig, cool und erstmal alle ignorierend tritt sie auf, entpuppt sich aber schnell als eine einsame und düster-sympathische Figur, mit einem Hang zum Drama. Es entspinnt sich in der Folge eine schwer zu definierende Beziehung zwischen den zwei jugendlichen Hauptcharakteren. Es geht um Adoleszenz in ihren Abstufungen, Verwirrungen und Gefahren, coming of age at its best. Chloé wird dabei für Bastien zu einer Art großen Schwester, die ihn in diese Aufregungen einführt: der erste Alkohol, die erste Zigarette, der erste Joint – aber auch weitere erste Male, denn Chloé strahlt parallel eine enorme körperliche Anziehung auf Bastien aus und genießt geradezu das Alters- und Machtgefälle. Bastien läuft meistens nur (ihr) hinterher. Zwischen seinem kindlichen kleinen Bruder Titi, der vollpubertären Chloé und ihren volljährigen Freunden steht Bastien genau auf der Schwelle – und wortwörtlich im Mittelpunkt, denn filmisch wird Bastien in Dialogen und Handlungshöhepunkten des Öfteren durchgängig in Groß-Einstellungen fokussiert. Es geht auch um seine bestimmte Perspektive, um das Spiel und Aufbrechen der vermeintlichen Altersgrenzen.
In der Graphic Novel reizte Bastian Vivès vor allem die Grenze und inzestuöse Anspannung der geschwisterlichen, aber gleichzeitig sexuellen Beziehung deutlich weiter aus und gestaltet die Handlung mit mehr Tiefe. Die Filmadaption versucht stattdessen auch die Abgründe einer Coming-of-age-story abzubilden. Gerade durch den bedachten Einsatz von Musik, bzw. ihr bewusstes Weglassen werden dunklere Töne angeschlagen und die Spannung gesteigert. Und kommt Musik, wie das wiederkehrende Leitmotiv des Sees, wird durch die fast mystischen Klänge von Klô Pelgag die dramatische Erwartungshaltung weiter genährt – irgendwann muss hier doch mal jemand sterben! Die düstere Rahmung spielt bewusst mit unserer Erwartungshaltung, teilweise herausfordernd und komisch mit wiederholten Anspielungen auf ‚typisch‘ dramatische Szenen. Gleichzeitig stolpert der Film damit aber des Öfteren ins oberflächlich Vorhersagbare – dem ersten Alkohol folgt die erste Übelkeit und auch die obligatorische Mutprobe darf nicht fehlen.
Es ist eine Balance, zwischen düsteren Vorahnungen und unbeschwerten Eskapaden, zwischen Authentizität und Klischee. Spätestens der Schluss überrascht aber, so offensichtlich er sich auch abzuzeichnen vermag, und sorgt für einen Kippmoment in die entgegengesetzte Richtung. Der Film unterhält, solange er läuft – und ist nicht direkt verklungen, sondern hallt gleich der Mondscheinsonate dunkel nach.